|
|

|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
Der Code als künstlerisches Material Codelab »in residence« im Podewil, Berlin |
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||
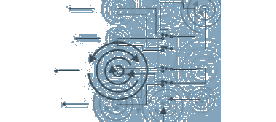
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Seit 1999 besteht das Codelab in Berlin. Den »Code als künstlerisches Material« zu begreifen, ist eines der wesentlichen Anliegen der Programmiererin und Künstlerin Ulrike Gabriel, Mitbegründerin und Leiterin des Labors. Seinen ersten Standort in der alten Ostbäckerei in Berlin-Mitte hat das Codelab zwischenzeitlich verlassen und residiert seit Beginn des Jahres im Podewil. »Auch wenn das Podewil sich zukünftig nicht als ein hoch profiliertes Medienlabor auszeichnen wird«, so der Medienkurator des Podewil und künstlerische Leiter der Transmediale, Andreas Broeckmann, »so wird doch mittelfristig über Kooperationen mit anderen Berliner Institutionen angestrebt, die medienkünstlerische Infrastruktur wie auch ihre Produktionsbedingungen insgesamt zu verbessern.« Bislang unabhängig von öffentlicher Förderung, gelang es dem Codelab, sich als kleine, selbstorganisierte Einheit zu behaupten. 

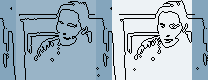
netzspannung.org: Aus der Dokumentation über das Codelab geht hervor, dass es aus der Geschichte der elektronischen Medienkunst heraus entstanden ist als konsequenter, notwendiger Schritt. Wie ist das zu verstehen? Ulrike Gabriel: Das Codelab ist gewachsen. Es gab bei allen Codelab-Künstlern einen langen Prozess, in dem sich bestimmte Arbeitsmethoden entwickelt haben und sich eine Sichtweise herausgefiltert hat, welche die generativen Systeme, an denen wir im Prozess arbeiten, als gemeinsamen Nenner begreift, unter dem das Lab funktionieren kann. Die Konsequenz aus dem Einsatz generativer Systeme ist, dass man die Computer quasi aufschraubt und als Material begreift, und man dann dementsprechend mit ihnen als Medium arbeitet. Dabei sind nicht »Multiple Medien« von Interesse, die nur Variationen von Displayformen sind, sondern das, was dahinter steht. Man kann sie als Material auf die Elektronik reduzieren und dann natürlich auf die Software, die diese Elektronik steuert. Ein konsequenter Schritt daraus ist, dass der Künstler Hardware und Software auch begreift, sie im wortwörtlichen Sinne anfasst und versteht, um sie frei einzusetzen. Er ist gleichzeitig ein Ingenieur. Wenn man ganz tief ansetzt, um das Material zu definieren, z.B. als Programmierung, schließt dieses Material automatisch die Displays aller programmierbaren Applikationen ein. Das Interesse verschiebt sich. Ein weiterer aus der Geschichte heraus konsequenter Schritt ist es, diesen Prozess auch zu untersuchen. Die Unterscheidungen sind dabei historisch noch nicht wirklich gemacht worden. Es ist gut, sie zu definieren. Zu welchem Zeitpunkt konstituierte sich das Codelab? Es gab diesen gemeinsamen Nenner, eine Gründerstimmung. Das erste Lab haben wir dann im Herbst '99 in der alten Ostbäckerei bezogen. Im Codelab laufen neben den Projekten mittlerweile verschiedene parallele, miteinander verzahnte Threads. Codelab als freies schulisches Environment haben Martin Carlé und ich letztes Jahr entwickelt. Im Moment gibt es hier einen Studenten. Danach galt es die Initiative Codelab so zu definieren, wie es derzeit im Podewil präsent ist. Unsere Kooperation mit Hochschulen und die Vernetzung mit anderen Labs werden wir weiter ausbauen. Seit '99 gibt es eine Kooperation mit der TU-Eindhoven: Studenten können innerhalb von Kunstprojekten Praktika machen, die ihnen für ihr Studium angerechnet werden. Letzten Herbst machten wir im Rahmen einer Ausstellung den ersten Codelab-Workshop in Eindhoven. Wir haben den Workshop als Installation ausgestellt und dort mit den Studenten zusammen im Prozess gearbeitet. Das ist der dritte Thread: ein Travel-Lab, das eben in Form von Installationen oder temporären Labors sich irgendwo andockt und dort genau diesen Prozess des »künstlerischen Engineering«, also gleichzeitig Ingenieur und Künstler zu sein, überträgt. Wie sehen die Kooperationen innerhalb des Codelabs, das Generieren verschiedener Arbeitsprozesse, aus? Die Projekte sind die eigentlichen Generatoren, die überhaupt die Dynamik schaffen. Projekt heißt: Es gibt einen Autor, einen Künstler, der für dieses Projekt steht. Die Projekte sind nicht vorkonzipiert und werden dann technisch ausgeführt, sondern es sind alles prozesshafte Projekte, die eine Frage stellen und möglicherweise keine finale Antwort darauf finden. Beim Entwickeln stellen sich immer neue Fragen, das generiert wieder neue Zusammenarbeit. Der Künstler steht in seinem Projekt als Motor in einem gesamten generativen System. Natürlich kooperieren die Leute untereinander. Ein weiterer Bereich sind dann Studien, die aus den Projekten heraus entstehen und sie begleiten. Was bedeutet das jetzt persönlich für Dich? Ich bin zwar so etwas wie der Kern, der das Projekt trägt, aber das Projekt ist selbst eine offene Zone. Ich arbeite in andere Projekte hinein und involviere andere in mein Projekt. Es ist keine abgeschlossene Sache, das ist inspirierend und macht Spaß. Auf welche Ressourcen greift das Codelab zurück? Bis jetzt war das Codelab selbsttragend durch die Projekte der Leute, die dort arbeiten. So auch die Schule, die durch Stipendien der Studenten finanziert wird. Der Projektbereich kann erst jetzt definiert werden und benötigt einen Finanzierungsplan. Eine andere Reihenfolge der Entwicklung des Codelabs hätte keinen Sinn gemacht. Die Projekte sollen eine solide Basis haben, damit die Zeit im Codelab ausschließlich für die Entwicklung genutzt werden kann. Ich stelle mir im Moment vor, dass jeder Künstler ein Stipendium bekommt und dazu ein Startbudget zum Projekt, das sich dann aus der Projektentwicklung selber trägt. Welche Projekte finden derzeit im Codelab statt? Pepe Jürgens setzt sich in seinem Projekt »Data Scapes« mit dem Informationsüberangebot von Weltbildern und ihrer Filterung auseinander. Christoph Kummerer entwickelt Netzkunstprojekte für extrem kleine Bandbreiten. Sandro Canavezzi befaßt sich in seinem Projekt »Kaleidoscopic Universe« mit Simulationen von Spiegelungen, die Information generieren und organisieren. Das Projekt »Independent Artist« von Francis Wittenberger hat einen autonomen Performance-Roboter zum Thema, dessen Verhalten aus der Kombination von Vererbungsstrukturen, Conceptual Dependency und vorhersagbarer Logik resultiert. Ich selber arbeite weiter an »Sphere«, das die authentische Realität als hybride versteht, die sich aus der digitalen und der physischen Wirklichkeit zusammensetzt. Wie siehst du die Rolle des Codelab im Podewil? Codelab ist »in residence« im Podewil. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass am Podewil derart mit Technologien gearbeitet und dieser Diskurs um Codierung im künstlerischen Kontext so eingebracht wird. Daraus entsteht eine neue Infrastruktur, die in Zukunft auch anderen Künstlern am Podewil zur Verfügung stehen wird. Wollt Ihr Euch als Codelab ebenfalls im Programm des Podewil einbringen? Ausgehend von den aktuellen Projekten werden wir die Spin-Offs thematisch aufgreifen und diese dann im Club des Podewil öffentlich machen. z.B. zu Sandros »Kaleidoscopic Universe« werden wir einen Mathematiker zu einem Workshop und Vortrag zum Thema »Symmetrie« einladen. Das wird das erste Mal etwas Öffentliches sein, da das Codelab bisher ein geschlossenes Studio war. Was immer das generative System Codelab an Aktuellem und Interessantem abwirft, werden wir versuchen auch spannend zu vermitteln. Schwerpunkt des Codelab ist die Erstellung künstlerischer Software und Hardware, wo Programmierung als künstlerisches Material als ein wichtiger Bestandteil angesehen wird. Seitdem es Computer oder Software gibt, den Code und Compiler, gibt es Künstler, die den Code dieser Technologien als eigentliches Material begreifen. Aber im Allgemeinen gibt es keinen selbstbewussten Umgang damit. Bisher wurde dieser Diskurs noch nicht explizit geführt. Es gibt einen Bruch des fiktionalen Paktes zwischen Benutzer - wobei das auch der Programmierer sein kann - und dem Code, den er vor sich hat. Diesen fiktionalen Pakt kann man erst dann brechen, wenn man versteht, was das Material ist. Das ist genau der gemeinsame Schnitt, den es schon immer gibt, seit Künstler mit Technologien arbeiten. Auf der Transmediale gab es erstmals die Kategorie »artistic software«. Man konnte sehen - es gibt kein Selbstverständnis dieser Form von Kunst. Das ist beim Codelab anders. Du warst Mitglied der Jury für »artistic software« anlässlich der Transmediale. Es gibt zu diesem Begriff unterschiedliche Statements von den einzelnen Jurymitgliedern. Ich würde gerne Deine Definition zu »artistic software« hören. Wie ist Dein Verständnis darüber? Bei mir ist es ganz explizit so, dass ich Programmierung selbst als künstlerisches Material begreife. Dieses Verständnis hat sich im Laufe meiner Arbeit so entwickelt. Für mich ist das Programmieren ein Abrieb am Material und am Prozess wie in der Malerei. Das geht auch mit Software und mit dem Code. Es führt nur zu einem anderen Ergebnis. Es ist ein ganz anderer Ansatz. Das Interesse verschiebt sich und führt zu einer spezifischen Betrachtung der Systeme. Es ist die Auseinandersetzung mit dem Code, die dabei wesentlich ist. Ich denke, man kann in der Informationsgesellschaft nicht künstlerisch forschen, ohne ihre Codes zu knacken. Man muss diese Codes aufreißen und sich mit ihnen auseinandersetzen. Wenn man das nicht schafft, betrachtet man nur eine illusorische Welt. Denn wie beschreibt man eine Welt, wenn man ihre Codes nicht knacken kann. [...] Ich stelle mir vor, dass eine authentische Realität zum einen aus ihren physischen, natürlichen Realitäten und zum anderen aus den ganzen Informationswelten besteht. Aber beides zusammmen ist eine authentische Realität, beides ist real. Es geht nicht mehr darum, ob etwas zwischen dem Virtuellen und dem Realen hin und her klappt, sondern sie bilden eine Einheit. Alles ist authentisch. Einen Teil versteht man vielleicht nicht und erklärt ihn sich deshalb als Blackbox, aus der irgendetwas herauskommt, was z.B. einen Börsen-Crash auslösen kann. Oder man versucht, zu verstehen, was man macht, wenn man an diesen Codes schraubt. Genau an diesen Schnittstellen dazwischen muß man forschen und versuchen zu verstehen, wie es funktioniert. Was verstehst Du unter Art OS? Es bedeutet sowohl Art Open Source als auch Art Operating System. Art OS war ein Projektvorschlag. Die Idee war, kollaborativ über eine Open Source- Plattform ein System zu programmieren, d.h., jeder sollte ein Modul programmieren, den »Shifter« einer Maschine, die anläßlich eines Kongresses, das Geschehen live kommentiert, zuhört und Stellung bezieht. Es wäre ein schöner Anlaß, die programmierenden Künstler zu vernetzen, und es ist spannend, welche Arbeitsformen sich dabei ergeben. Zudem würde ein interessantes Archiv an Code-Ressourcen entstehen. Wie siehst Du die Querverbindung zum heutigen Codelab? War der Projektvorschlag von Art OS ein Vorläufer der heutigen kollaborativen Arbeitsform des Codelab? Als Vorläufer würde ich es nicht bezeichnen, wir werden das sicher noch realisieren. Könntest Du die Unterschiede medienkünstlerischer Produktion oder Arbeitsbedingungen in Japan und Deutschland im Vergleich vermitteln - hinsichtlich Deiner Erfahrungen von Kooperationen mit dem Canon ARTLab Tokyo (»Perceptual Arena«,1993) und mit dem Institut für Neue Medien in Frankfurt (»Terrain 01«,1993). Die Kooperation mit dem Canon ArtLab haben wir hier in Deutschland entwickelt und dabei mit japanischen Ingenieuren, die damals im ArtLab waren, zusammengearbeitet. Das Canon ArtLab ist mittlerweile auch in dem Sinne gewachsen, dass es sich innerhalb von Canon etabliert hat und einen sehr freien Raum für die dort stattfindenden Projekte geschaffen hat. Die Zusammenarbeit ist jetzt schon lange her, ich glaube aber, es war relativ neu, dass sich Künstler so tief in die Materie hineinbegeben haben. Und es war sicherlich für ArtLab auch interessant, dass man als Künstler und Ingenieur kooperiert, indem man gemeinsam an der Software strickt. Ich habe in der Zeit mit Bob O´Kane zusammengearbeitet. Wir haben dieses Künstler-Ingenieur Verhältnis gemeinsam benannt: Derjenige, der mehr auf der technologischen Ebene arbeitet, begibt sich genauso tief in die künstlerische Seite hinein wie andersherum. Dadurch steht man auf einer Stufe im Projekt. Es ermöglicht ein prozesshaftes Arbeiten, wo man gemeinsam am Material »knetet«. War es in Frankfurt am Institut für Neue Medien ähnlich? Francis Wittenberger und Bob O' Kane waren ebenfalls am Institut für Neue Medien in Frankfurt. Künstler wie Michael Saup und Akke Wagenaar haben damals schon »gecoded«. Es waren ca. 2-3 Jahre, wo sehr wesentliche neue Sachen entstanden und umgesetzt wurden. Dieses Institut war ein sehr kleines, dynamisches und nicht »verinstitutionalisiertes« Gebilde. Es war wie ein Ufo. Es ist in dieser Form dann auch schnell wieder verschwunden. Aber es war eine sehr inspirierte und intensive Zeit, ich glaube für alle, die dort gearbeitet haben, und auch für die, die von überall aus der Welt dorthin kamen. Wie beurteilst Du die Produktionsmöglichkeiten für Medienkünstler in Deutschland heute? Und was denkst Du, welcher Bedarf an Produktionsmöglichkeiten besteht? Die Produktionsmöglichkeiten sind gut, man braucht keine Hochleistungsrechner mehr und Vernetzung ist auch kein Problem. Es kann jeder noch so kleine PC sein, wenn man ihn versteht. Ich glaube, viel wichtiger ist der Bedarf an Knowhow, es ist schwierig, das Knowhow überhaupt zu bewältigen. Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Wege das zu tun: der eine - konventionelle - geht über Personal, das technische Probleme löst; der andere ist das Knowhow im Sinne von Verständnis, was man fördern und erzeugen muß, d.h., es braucht auch eine Quelle. Zur Zeit wird allgemein viel darüber reflektiert, wie man Curricula an Medienhochschulen formuliert. Wäre es nicht interessant, in diesem Umfeld die Idee des »Codes als künstlerisches Material« zu vermitteln, um zu sagen, so müsste zukünftig ausgebildet werden? Doch, natürlich. Zum Beispiel ist es vorgekommen, dass an einer Medienkunsthochschule Künstler große Schwierigkeiten bekamen, weil sie ein Sniff-Programm laufen ließen, am Wochenende aber kein System-Operator anwesend war und die Künstler sich selbst helfen mussten. Anstatt diese Situation anerkennend zu registrieren, wurden sie unter falschen Voraussetzungen als Hacker bezeichnet. Es liegt wohl daran, dass es noch keine Verbindung zu Lehrinhalten gibt. Man erkennt daran, dass die Schulen den Illusionen vernetzter Applikationen und ihrer erfundenen Gesetze noch voll aufsitzen. Wie sollen Studenten da einen freien Blick entwickeln? Ganz abgesehen von Codes als künstlerischem Material - schon allein weil sich nur an der Oberfläche viel ändert, lohnt es sich tiefer zu gehen. Die Sprache 'C' z.B. lernt man immer noch mit einem Buch von 1978. Da hat sich nichts geändert, außer an der Medien-Oberfläche und in der Peripherie. Es wird keinen finalen Technologiekurs geben, das ganze ist ein dynamisches Feld, und es bewegt sich ständig. Wenn man eine Sprache gelernt hat, ist es leicht, eine weitere zu lernen. Auf längere Sicht ist wird man Wege finden müssen, wie man sich Wissen aneignet. Das geschieht ja nicht in zwei Jahren Unterricht oder einem Studiengang, sondern vielleicht in dreißig Jahren, in denen man prozesshaft mit Technologie arbeitet. Ich denke, die Kunst und Medienhochschulen brauchen deshalb erst mal einen Elektroniktisch und Programmierkurse. Die Studenten brauchen die Codes sowohl auf der Hardware- wie auf der Softwareebene, um den Blick zu befreien. Die nächste wirkliche Veränderung ist vielleicht der Quantencomputer, wenn er dann wirklich funktioniert. Wir danken dir für das Gespräch.
Gesprächsteilnehmer:
Das Gespräch für netzspannung.org führten: Berlin am 10. März 2001 |
|||||||||

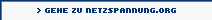






 Intro
Intro